Prof. Dr. Anna Hirsch
Laufzeit
Fördersumme Saarland
Fördersumme gesamt
Partner
Weltweit wird die Bekämpfung vieler bakterieller Infektionen inzwischen dadurch erschwert, dass die Keime Resistenzen gegen Antibiotika entwickelt haben. Infektionskrankheiten lassen sich dadurch meist schwieriger behandeln und es kann mitunter zu schwerwiegenden Komplikationen kommen. Vor diesem Hintergrund zielt die Wirkstoffforschung darauf ab, Medikamente mit einer neuartigen Wirkungsweise zu entwickeln. Dank neuer Analysemethoden wie beispielsweise der Sequenzierung ganzer Genome, stehen den Wissenschaftlern hierfür detaillierte biologische Informationen zur Verfügung. Ausgangspunkt der Entwicklung eines neuen Wirkstoffs ist die Identifizierung eines Zielproteins – eines sogenannten „Drug Targets“, das eine Schlüsselfunktion in einer Krankheit einnimmt. Hier setzt auch die Forschungsarbeit von Anna Hirsch an, die im Rahmen ihres ERC Projekts versucht, mittels innovativer Methoden neue Moleküle zu bestimmen, die auf diese Zielproteine in einer bestimmten Weise wirken und somit die Basis für die Entwicklung eines neuen Arzneimittels legen.
„Das Potenzial, dass die Ergebnisse meiner Forschungsarbeit vielleicht tatsächlich irgendwann einmal Menschen helfen könnten, hat mich immer schon motiviert und angetrieben.“
Anna Hirsch forscht seit 2017 am Helmholtz-Institut für Pharmazeutische Forschung Saarland (HIPS) an der Entwicklung neuer Arzneimittel gegen Infektionskrankheiten – unter anderem mithilfe eines Starting Grant des European Research Council. Neben ihrer Tätigkeit am HIPS ist Anna Hirsch Professorin für Medizinische Chemie an der Universität des Saarlandes. Wir haben sie zu einem Gespräch getroffen.
Können Sie Ihr Forschungsgebiet und -interesse kurz beschreiben?
Mein Forschungsinteresse gilt in erster Linie dem Bereich der so genannten „Antiinfektiva“, also der Entwicklung neuer Arzneimittel und Therapiemöglichkeiten gegen Infektionskrankheiten. Das ist auch der Forschungsfokus des Helmholtz-Institut für Pharmazeutische Forschung Saarland (HIPS), an dem ich arbeite. Es gibt aktuell im Zusammenhang mit Infektionskrankheiten ein immer größeres Problem mit Resistenz-Entwicklung, über die zuletzt auch häufig in den Medien berichtet wurde, vor allem Antibiotika-Resistenz. Insofern ist es dringend notwendig, dass man mittels innovativer Methoden neue Moleküle findet, die letztlich zu einem neuen Antiinfektivum entwickelt werden können. Die Basis hierfür ist, dass diese Moleküle auf neuen, so genannten „Targets“ wirken. Targets sind häufig Proteine, die später in unseren Organismen zum eigentlichen therapeutischen Effekt führen, weil man sie durch die Moleküle in ihrer Funktion oder Struktur beeinflussen kann. Und genau das versuchen wir.
Was waren zuletzt konkrete Erfolge Ihrer wissenschaftlichen Arbeit?
Einige wirklich wichtige „Durchbrüche“ haben wir zuletzt vor allem im Bereich der Methoden erzielt. Hier konnten wir tatsächlich belegen, dass die von uns entwickelten innovativen Herangehensweisen tatsächlich funktionieren. Der nächste Schritt ist nun natürlich, dass wir – und auch andere Forschungsgruppen –, diese Methoden mehr und mehr anwenden. Wir fokussieren uns dabei vornehmlich auf bakterielle Infektionen und hier vor allem auf die „Gram-negativen Bakterien“, die im Zusammenhang mit Antibiotika-Resistenzen das größte Risiko darstellen. Häufig kommen diese Bakterien beispielsweise bei Entzündungen in der Lunge vor. Im letzten Jahr ist es uns gelungen für verschiedene Targets, äußerst vielversprechende Moleküle zu entdecken, die wir zurzeit weiter optimieren.
Was fasziniert Sie an Ihrem Themengebiet am meisten? Wollten Sie schon immer in diesem Bereich forschen?
Geträumt habe ich von einer Tätigkeit in diesem Gebiet tatsächlich schon als Studentin. Aber ich hatte damals durchaus Zweifel, ob das überhaupt möglich sein würde. Ich habe dann im Rahmen meiner Doktorarbeit in einem ähnlichen Gebiet geforscht. Dabei ging es zwar vor allem um neue Wirkstoffe zur Behandlung von Malaria, aber damit hatte ich schon erste Erfahrungen im Bereich der Antiinfektiva gesammelt. Besonders faszinierend an diesem Themenfeld fand ich schon immer, dass wir auf akademischer Seite zwar zunächst absolute Grundlagenforschung betreiben, aber dennoch prinzipiell die Chance besteht, langfristig soweit zu kommen, dass das, was wir entwickeln, auch tatsächlich irgendwann Menschen helfen könnte. Dieses Potenzial hat mich immer schon begeistert und angetrieben.
Seit ich hier am HIPS bin, wird das Ganze auch noch einmal deutlich konkreter: Denn es gehört ganz eindeutig zur Erwartungshaltung an ein Helmholtz-Institut oder -Zentrum und wird auch entsprechend unterstützt, dass man einerseits hochqualitative Grundlagenforschung macht, aber spannende Ergebnisse hieraus dann auch in Richtung Translation, also hin zur konkreten Anwendung weiterverfolgt. Hierfür gibt es auch entsprechende Unterstützung.
Woran forschen Sie aktuell? Und wie sieht der Forschungsprozess aus?
Im Wesentlichen arbeiten wir aktuell an zwei Strängen von Projekten: Bei dem einen handelt es sich um die Erforschung der schon erwähnten neuen Methoden, die wir aktuell etablieren und für die wir nach neuen Anwendungsbeispielen suchen. Der zweite Strang ist eine Reihe klassischer „medizinal-chemischer“ Projekte. Hierbei schauen wir uns verschiedene Antiinfektiva-Targets, also unterschiedliche Proteine, an und versuchen anhand von neuen oder bereits bestehenden Methoden und Ansätzen zu bestimmten Molekülen zu gelangen, die mit diesen Proteinen eine Wechselwirkung und hoffentlich den gewünschten Effekt zeigen. Diese Prozesse müssen dann meistens im Anschluss in langjährigen Verfahren stetig verbessert werden. Hierbei ist es wichtig, dass man nicht nur im Reagenzglas mit dem isolierten Protein den gewünschten Effekt sieht, sondern auch in Zellen. Das sind im Fall der Antibiotika bestimmte Bakterienkulturen, bei denen wir uns anschauen, ob sie das Bakterienwachstum beeinträchtigen oder nicht. Das können wir auch größtenteils hier im Institut machen. Parallel dazu überprüfen wir „in vitro“ und dann auch „in vivo“, ob die Moleküle geeignete Eigenschaften zur Weiterentwicklung zu einem Wirkstoff haben. Danach würde man die vielversprechendsten Moleküle in ersten „in-vivo“-Infektionsmodellen beispielsweise an Zebrafischen oder Mäusen überprüfen. An diesen Punkt wollen wir mit unserer Forschung kommen. Wenn all diese Schritte erfolgreich waren, würde man beginnen in Richtung klinischer Studie zu denken.
Wie lange dauert dieser Prozess einer solchen neuen Wirkstoffentwicklung insgesamt?
In einer Pharmafirma spricht man im Allgemeinen von zehn bis zwölf Jahren. Wir hier im Institut arbeiten natürlich mit einer viel kleineren Gruppe an Mitarbeitern an solchen Projekten. Dementsprechend dauert es deutlich länger. Das Ziel unserer Projekte ist es, in erster Linie, in die so genannte „prä-klinische“ Phase zu kommen. Das heißt, wir müssen in einem ersten in-vivo Experiment zeigen, dass wir den gewünschten therapeutischen Effekt erzielen können. Bei Erfolg steigt im Anschluss womöglich eine Pharma-Firma oder eine Nichtregierungsorganisation ein und belgeiten den Prozess aktiv weiter oder übernimmt ihn sogar.
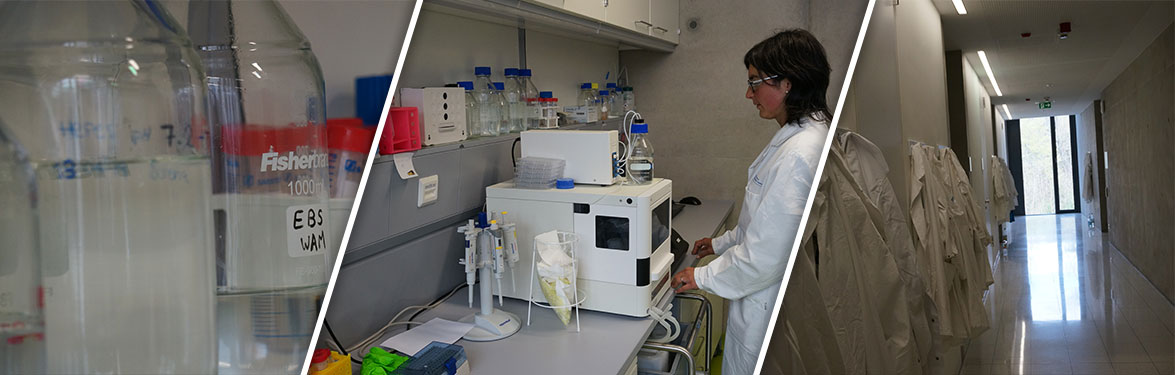
Wie würden Sie die Zusammenarbeit mit Partnern aus der Industrie bewerten? Arbeiten Sie in den Projekten mit Pharmaunternehmen zusammen?
Wir haben es durchaus häufiger, dass wir mit Pharmaunternehmen als Mentoren in Projekten zusammenarbeiten, die dann eher eine beratende Funktion einnehmen und sehr eng mitverfolgen, wie sich das Projekt entwickelt. Aber alle sagen im Grunde, dass sie erst dann wirklich in den Forschungsprozess einsteigen können, wenn ein „in-vivo“-Modell erfolgreich war. Und um dorthin zu kommen, muss man wie gesagt bereits eine Reihe an mitunter sehr kostspieligen Studien gemacht haben, für die häufig auch die „normalen“ Förderquellen nicht geeignet bzw. gar nicht erst gedacht sind.
Ein großes Problem ist aktuell auch, dass es kaum noch Firmen gibt, die Antiinfektiva-Forschung betreiben, weil das allgemeine Business Modell der meisten Pharmafirmen nicht recht zu diesem Forschungsfeld passt. Sie konzentrieren sich meist auf andere „große“ Gesellschaftskrankheiten wie Krebs und nicht auf das Erforschen neuer Antibiotika, die man ja auch nur für einen sehr begrenzten Zeitraum einnimmt – anders als bei Asthma oder Bluthochdruck beispielsweise.
Dazu kommt, dass die Entwicklung neuer Antibiotika viel schwieriger und das Risiko, dass der Prozess scheitert, viel größer ist. Und wenn es gut geht und das neue Antibiotikum auf den Markt käme, würde man es sich eigentlich vor allem für die vereinzelten Fälle von Infektionen „reservieren“ wollen, bei denen es sich tatsächlich um multi-resistente Keimstämme handelt. Die breite Masse der anderen Patienten würde weiterhin mit bestehenden Präparaten behandelt. Es wären folglich während der Patentlaufzeit nur ganz wenige Patienten, die damit behandelt werden könnten. Wir benötigen also auch strukturell neue Ideen und Ansätze, um die Entwicklung dieser Präparate auch von wirtschaftlicher Seite attraktiver zu machen. Es gibt beispielsweise Überlegungen, die Patentlaufzeit für solche Medikamente zu verlängern, um entsprechend mehr Patienten innerhalb dieser Zeit behandeln zu können. Es fehlt aber auch ein stückweit an Kenntnis und Bewusstsein für diese Erkrankungen. Auch wenn es derzeit vermehrt Bewegungen und Initiativen gibt, die für die Bedeutung der Forschung im Bereich bakterieller Erkrankungen sensibilisieren und neue Finanzierungsinstrumente bereitstellen.
In die Zukunft geblickt: Wo stünden Sie mit Ihrer Forschungsarbeit gern in 10 Jahren?
Einige „unserer“ neu identifizierten Moleküle haben wir in den letzten Monaten bereits in simplen „in-vivo“-Infektionsmodellen evaluiert und arbeiten in diese Richtung weiter. Grundsätzlich würde ich mir wünschen, dass wir im Rahmen unserer Projekte erfolgreich einen (oder mehrere) präklinische Kandidaten identifizieren, der dann von einer Pharmafirma oder einer gemeinnützigen eher anwendungsorientierten Initiative aufgegriffen und weiterentwickelt wird.
Sie sind nach mehreren Auslandsaufenthalten seit 2017 im Saarland. Was hat Sie hierher „verschlagen“ und wie bewerten Sie die Arbeitsbedingungen vor Ort?
Interessante Frage: Bei meiner letzten Station in Groningen hatte ich eigentlich bereits eine entfristete Stelle als „Associate Professor“. Also hätte ich eigentlich dort bleiben können (Anna Hirsch lacht). Ein Manko war und ist allerdings die Drittmittellage in den Niederlanden. Es ist dort recht schwierig, nationale Fördermittel einzuwerben und es gibt schlichtweg weniger Fördergelder. Letztere sind daher entsprechend hart umkämpft. Folglich sind die Erfolgsquoten leider auch sehr niedrig. Die Drittmittellage in Deutschland ist dazu im Vergleich um einiges besser und es gibt eine qualitativ hohe „Grundausstattung“, die es in vielen anderen europäischen Ländern gar nicht gibt. Das hat mich durchaus gereizt.
Ich muss aber auch gestehen, dass das HIPS als Forschungsinstitut wirklich ein fantastisches, ich würde fast sagen, einzigartiges Forschungsumfeld bietet:
Die Größe ist ideal, das Institut verfügt über eine hervorragende Infrastruktur und nicht zuletzt der Forschungsfokus bieten mir hier wirklich optimale Bedingungen für meine Arbeit. Insbesondere der klare thematische Fokus bewirkt, dass ich sehr schnell und problemlos mit Kollegen kooperieren kann. Wenn wir zum Beispiel einen bestimmten Stamm nicht in der Abteilung haben, gibt es ihn ein Stockwerk höher. Sprich, auch wenn ich in meiner täglichen Arbeit, bestimmte Infrastrukturen nicht direkt brauche, sind sie da und ich kann sie bei Bedarf nutzen. Die verschiedenen Expertisen sind hier sehr gebündelt vorhanden und das Forschungsniveau ist dadurch extrem hoch.
Welche Rolle spielen EU-Forschungsfördermöglichkeiten insgesamt für Ihren Wissenschaftsbereich?
Grundsätzlich habe ich das Gefühl, dass es auf EU-Ebene bisher in meinem Bereich eher etwas schwieriger war – ob im Rahmen des ERC oder auch in Hinblick auf größere Forschungsverbünde – erfolgreich zu sein. Der ERC hat auch erst in diesem Jahr erstmals das Schlagwort „Medizinalchemie“ als offizielle Kategorie für den ERC eingeführt. Es war also bisher wirklich eher schwierig, weshalb ich meinen ERC-Antrag damals auch bewusst auf die Methoden ausgerichtet hatte. Abgesehen vom ERC bieten die die Initial Training Networks (ITN) interessante Möglichkeiten der Zusammenarbeit. Solche Forschungskooperationen im nationalen oder internationalen Rahmen sind zweifelsfrei sehr wichtig für meinen Bereich. Zusammengefasst: die EU-Förderung habe ich durchaus im Blick, aber die nationalen Möglichkeiten sind natürlich genauso interessant. Insgesamt ist es meines Erachtens unabdingbar – unabhängig von Wissenschaftsdisziplin und individueller Institution – unterschiedliche Quellen von Drittmittel zu berücksichtigen und einzuwerben. Das gehört schlichtweg dazu.
Sie haben im Jahr 2017 einen ERC-Starting Grant „gewonnen“. Was bedeutet und ermöglicht Ihnen dieser prestigeträchtige Preis?
Ganz konkret ermöglicht mir der ERC natürlich erst einmal das Einstellen von Mitarbeitern, die ich ganz gezielt für die im ERC beschriebenen Projekte einsetzen kann. Das ist ein ganz klarer Mehrwert dieses Grants. Es macht natürlich einen riesigen Unterschied, ob mir beispielsweise in einem BMBF-geförderten Verbundprojekt ein Doktorand zur Verfügung steht, oder durch den ERC gleich drei Doktoranden und ein Post-Doc und eine Technische Assistenz-Stelle. Darüber hinaus kann man denke ich schon sagen, dass der ERC eine Art „Gütesiegel“ ist und für mich als Wissenschaftlerin ein hohes Maß an Visibilität schafft – sowohl ganz lokal hier am Standort Saarbrücken, aber auch national und international. Ich glaube schon, dass diese Auszeichnung einen enormen Einfluss auf zukünftige Anträge, Preise oder Berufungen haben kann. Auch für mögliche nachfolgende ERC-Grants wie den Consolidator Grant ist er sicherlich eine gute Ausgangsbasis.

Anna Hirsch studierte Naturwissenschaften an der Universität von Cambridge (England) mit einem Schwerpunkt in Chemie. Sie promovierte zum Thema "A Novel Approach towards Antimalarials: Design and Synthesis of Inhibitors of the Kinase IspE" unter Leitung von François Diederich an der ETH Zürich (Schweiz). Nach einem Aufenthalt als Postdoc in Strasbourg (Frankreich) unter der Leitung von Jean-Marie Lehn übernahm Anna Hirsch 2010 eine Stelle als Assistant Professor und 2015 als Associate Professor für Strukturbasierte Wirkstoffentwicklung an der Universität von Groningen (Niederlande). Seit 2017 ist Hirsch Professorin für Medizinische Chemie an der Universität des Saarlandes und leitet am Helmholtz-Institut für Pharmazeutische Forschung Saarland (HIPS) die Abteilung „Wirkstoffdesign und Optimierung“. Hauptziel ihrer Arbeit ist es, die internationale Sichtbarkeit auf dem Gebiet der Entwicklung neuer Anti-Infektiva und Hitidentifikationsmethoden weiter zu erhöhen. Anna Hirsch wurde mit folgenden Preisen geehrt: Gratama Science Award (2014), SCT-Servier Prize für Medizinalchemie (2016) und Innovationspreis für Medizinalchemie der GdCh/DPhG (2017).

